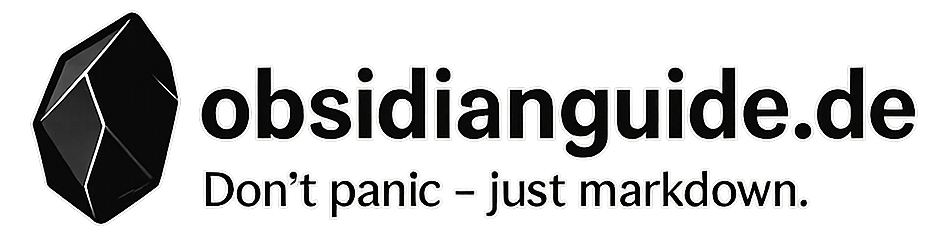Personal Knowledge Management
Da du diese Zeilen liest, bist du sicherlich auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Flut von Informationen aus Büchern, Artikeln, Kursen, Podcasts, Gesprächen usw. zu sammeln und in Wissen zu transformieren.
Dieser Prozess wird Personal Knowledge Management (PKM) genannt. In den letzten Jahren hat PKM einen regelrechten Boom erlebt; es wurden viele Methoden entwickelt und diskutiert, denen jedoch allen eine Grundannahme gemein ist:
Das Ziel ist, Informationen nicht einfach nur zu aufnehmen, sondern sie wirklich zu verstehen, zu analysieren und zu synthetisieren. Analysieren heißt, die Inhalte in ihre Einzelteile zu zerlegen, Zusammenhänge zu erkennen und Strukturen sichtbar zu machen. Synthetisieren bedeutet, diese einzelnen Bausteine wieder zu etwas Neuem zusammenzusetzen – zum Beispiel, indem du verschiedene Quellen kombinierst oder eigene Schlüsse daraus ziehst. Erst wenn du diesen Prozess durchläufst und die neuen Erkenntnisse mit deinem bestehenden Wissen verknüpfst, entsteht echtes, nutzbares Wissen.
Eine Methode zur Wissensakquise im Kontext von Personal Knowledge Management (PKM) sollte genau diesen Prozess unterstützen. Es geht nicht einfach nur darum, etwas zu tun, sondern darum, wie diese Aktivität zum Aufbau deines Wissens beitragen kann. Dazu geben einige Ansätze, die einen strukturieren Rahmen für die Organisation und Weiterentwicklung von Wissens bieten:
#Zettelkasten
Der Zettelkasten ist ein System zur Wissensvernetzung, das auf lose, miteinander verknüpfte Notizen setzt. Jede Notiz (Zettel) enthält eine Idee oder Information und wird mit anderen Notizen logisch verbunden. Ziel ist es, ein wachsendes, organisch vernetztes Wissensnetz zu schaffen, das kreatives Denken und neue Einsichten fördert. Ein bekannter Vertreter dieses Ansatzes ist Niklas Luhmann, der sein Wissensnetz noch mit Karteikarten organisierte (s.a. Niklas Luhmann-Archiv).
#Second Brain
Second Brain ist ein umfassendes Framework von Tiago Forte, das darauf abzielt, ein externes, digitales Gedächtnis aufzubauen. Es kombiniert zwei zentrale Bausteine: das Organisationssystem PARA und das Prozessmodell CODE. Während PARA alle Informationen in vier Kategorien (Projects, Areas, Resources, Archives) strukturiert, beschreibt CODE die vier Schritte im Umgang mit Wissen: Capture (Einfangen von Informationen), Organize (Strukturieren), Distill (Verdichten auf das Wesentliche) und Express (Anwenden und Teilen des Wissens). Gemeinsam ermöglichen diese Ansätze, Wissen effizient zu sammeln, zu verarbeiten und gezielt wiederzufinden.
PARA und CODE sind somit keine konkurrierenden, sondern sich ergänzende Komponenten innerhalb des Second Brain-Konzepts. Sie helfen dabei, sowohl die Ordnung als auch den Fluss der eigenen Wissensarbeit systematisch zu gestalten.
#Cornell-Methode
Die Cornell-Methode ist eine strukturierte Notiztechnik, die vor allem im Studium beliebt ist. Eine Seite wird in drei Bereiche unterteilt: Notizen, Randspalte für Stichworte/Fragen und ein Feld für die Zusammenfassung. Das fördert das aktive Nacharbeiten und Wiederholen von Inhalten. Sie wurde schon in den 1950er Jahren von Prof. Walter Pauk an der Cornell University entwickelt.
#Bullet Journal
Das Bullet Journal ist ein analoges (und digital adaptierbares) System zur Aufgaben- und Notizorganisation. Es arbeitet mit kurzen, stichpunktartigen Einträgen („Bullets“) für Aufgaben, Notizen und Termine. Durch Symbole und eine flexible Struktur lässt sich das System individuell anpassen und für Planung, Reflexion und Wissenssammlung nutzen.
#SQ3R-Methode
Die SQ3R-Methode wurde von Francis P. Robinson 1946 entwickelt und ist eine strukturierte Lesetechnik, die das Verständnis und Behalten von Texten durch fünf aufeinanderfolgende Schritte fördert: Survey, Question, Read, Recite, Review. Sie wird zwar nicht so prominent wie die anderen Frameworks in der PKM-Szene diskutiert, aber wird als klassische, effektive Lesemethode auch weiterhin empfohlen
Diese Ansätze lassen sich sowohl analog als auch digital umsetzen – mit einem einzelnen Tool oder einer ganzen Toolchain. Sie dienen in erster Linie als Rahmen und Orientierungshilfe für das eigene Wissensmanagement.
Allerdings besteht die Gefahr, dass solche Frameworks nicht nur als Inspiration genutzt, sondern fast schon dogmatisch verfolgt werden. Scheitert das Wissensmanagement dann an individuellen Bedürfnissen oder Erwartungen, wird die Enttäuschung oft dem verwendeten Tool zugeschrieben – anstatt die Methode flexibel an die eigenen Anforderungen anzupassen.
Aus diesem Grund wird das Thema in diesem Guide nicht weiter vertieft. Im Fokus steht hier ein Werkzeug, das so flexibel ist, dass es die verschiedenen Ansätze unterstützt – dir aber vor allem dabei hilft, deinen eigenen Weg im Wissensmanagement zu finden.